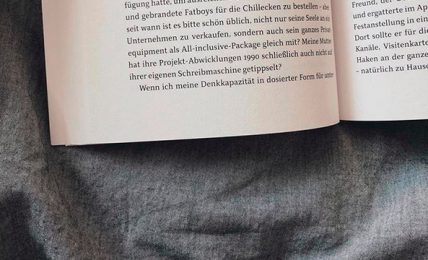Doris Knecht ist bekannt für ihre Kolumnen. Darin behandelt sie vorwiegend (zu 99,9 %) Probleme der privilegierten “Oberschicht”, die mit dem (eigenen und beobachteten) Bobo-Dasein inklusive Zweitwohnsitz im Waldviertel so einhergehen. Falls gerade nicht der Smartphone-Gebrauch des Nachwuchses auf kulturpessimistischste Weise auf der vorletzten Seite des Falters an den Pranger gestellt werden kann. „Man muss bei so einer Party [Kindergeburtstag, Anm.] natürlich frühzeitig die Smartphones kassieren“, predigt Knecht in Falter Ausgabe 22/14. Statt Aufklärung zu betreiben, folgt gänzliches Verbot, welche „Bestürzung, Hilflosigkeit, Verstörung und Trauer“ bei den Kindern hervorruft. Man möchte fragen: “Doris, hast du nichts aus deiner eigenen Jugend gelernt?” Aber dazu vielleicht ein andermal. Neben ihren umfangreichen mütterlichen Kompetenzen, um die ich ihre „Mimis“ im Übrigen nicht beneide („Um zwei Uhr früh hielt ich im Kinderzimmer mit fester Stimme einen kleinen Vortrag darüber, dass sich viele Probleme tatsächlich ganz simpel mit Schlafen lösen lassen!“) schreibt die Trägerin des Buchpreises der Stiftung Ravensburger Verlag (Vgl. Wikipedia) auch hin und wieder mehr als durchschnittliche Romane, die ich mir dann in einer schwachen Minute beim Uniflohmarkt kaufe. Und anschließend auch lesen muss – 4 Euro sollen nicht umsonst gewesen sein.
„Gruber geht“ vereint die Storyline aller schlechten Romane, die in den vergangenen fünf Jahren geschrieben wurden. Der Hauptprotagonist, John Gruber, könnte nicht stereotyper charakterisiert werden. Er ist ein reicher, fescher Banker, ein sich prügelnder Alkoholiker, Frauenheld ohne Kochkenntnisse und wird etwa zu Beginn des zweiten Drittels ganz plötzlich von der Nachricht überrascht, Krebs zu haben.
Er erzählte ihr von den lebenden Toten in den Wartebereichen der onkologischen Abteilungen (…) Und sogar von den Nächten, in denen er wach lag und an die Metastasen dachte, die vielleicht an seinen Knochen und Organen nagten, und ans Sterben, und was danach kommt, und ob er einfach nur tot sein werde, ein kleines schwarzes Loch im Nichts.
Ein Hohn für alle, die tatsächlich jemanden aufgrund dieser Krankheit verloren haben oder selbst daran leiden. Warum nur muss immer wieder Krebs als ultimatives Heilmittel für den spannungslosen Aufbau eines Plots herangezogen werden, wenn dieser nach einer tragischen Wendung schreit. Kann man nur so zu Selbstreflexion gelangen? Ist dies nicht gerade der einfachste Weg, den eine Hauptfigur – hinsichtlich der psychischen Weiterentwicklung – gehen kann? Es kommt die Wendung, die Einsicht, die Erkenntnis, das darauf folgende Glück in einem neuen Leben. Ohne die alten Laster, endlich kann man seine Vergangenheit als die begreifen, die sie war. Hinter sich lassen.
Zwischendrin hört man klar und deutlich die Kolumnen-Mutter:
Dass sie [Kinder, Anm.] zum Beispiel immer viel zu laut sind und praktisch ausschließlich Frequenzen benutzen, die den Ohren von Erwachsenen schlicht unzumutbar sind. Schädlich eigentlich. Eltern halten das eben gerade noch aus, okay, die schalten mit der Zeit vor lauter Erschöpfung wahrscheinlich einfach irgendwie ab. Eltern muss die Brut wahrscheinlich in alarmistischen Tonlagen bei der Strange halten (…).
Die als „schmissig und pointenreich“ titulierte Schreibweise, die im Klappentext beworben wird, offenbart sich durchaus an manchen Stellen. Und obwohl der/die LeserIn weiß, dass die Gedanken nicht (immer) jenen der Autorin entsprechen, sind manche Stellen derart grobkörnig und realitätsfern geschildert, dass die missglückte Szenarienbeschreibung nur schwer in Worte zu fassen ist.
Er hat den Porsche am Straßenrand geparkt, ungern, bei all den besoffenen Bauern, die ihre Traktoren durch die Gegend jagen, aber eine Garage gibt es hier ja nicht.
Kann man Stereotypen vorbeugen, indem man diese selbst reproduziert? 237 Seiten lang? Natürlich mit dieser gewissen Ironie, man ist ja nur die Schriftstellerin, man will ja auch lustig sein und nicht immer alles so ernst nehmen. Oder war das sowieso nicht das Ziel dieses Meisterwerks? Neben John gibt es auch noch seine ehemals suchtgefährdete Schwester Kathi, die jetzt ein Leben in der Idylle führt, einen „Spießer“ geheiratet und drei Kinder bekommen hat. Ein Leben zwischen Flohmarktmöbeln, Ikea-Küche und Guerilla Gardening. Diese Schilderungen sind stilistisch wohl noch die besten, und wir vermuten jetzt böswillig, vielleicht auch biografischsten. Zumindest wenn man von der sich damit bewahrheitenden These ausgeht, dass man nichts wirklich Authentisches schreiben kann, das man nicht auch selbst erlebt hat.
Irgendwann, hat sich Doris Knecht wohl gedacht, muss sie ihren Protagonisten wohl doch einfangen, den Testosteronhansel zähmen. Und weil ihr bei dem Gedanken vielleicht selbst nicht ganz wohl war, hat sie es auf den letzten 20 Seiten schnell hinter sich gebracht. Das bringt den Roman um ein schlüssiges Ende und ihren Protagonisten um seine Glaubwürdigkeit. Am Ende ist der schönste Teil von Gruber wirklich gegangen. Nicht an den Krebs, sondern an die Mittelmäßigkeit. (zeit.de)
Trotz des seichten Plots hat Knecht es wieder geschafft: Mich zum Lesen zu bewegen. Wie bei den Kolumnen, die ich jedes Mal zuerst verschlinge, wenn ich den Falter aufschlage. Um mich hinterher aufzuregen. Um diese Rezension mit den Worten von Carolin Ströbele zum Schluss zu bringen: “Für einen guten Roman reicht das noch nicht.”
Doris Knecht: Gruber geht. Rowohlt 2011
Fotoquelle: Josefine v. Eisenhart