Ich bin nicht meine Texte oder: was kreative Arbeit mit diesem Liebesleben macht
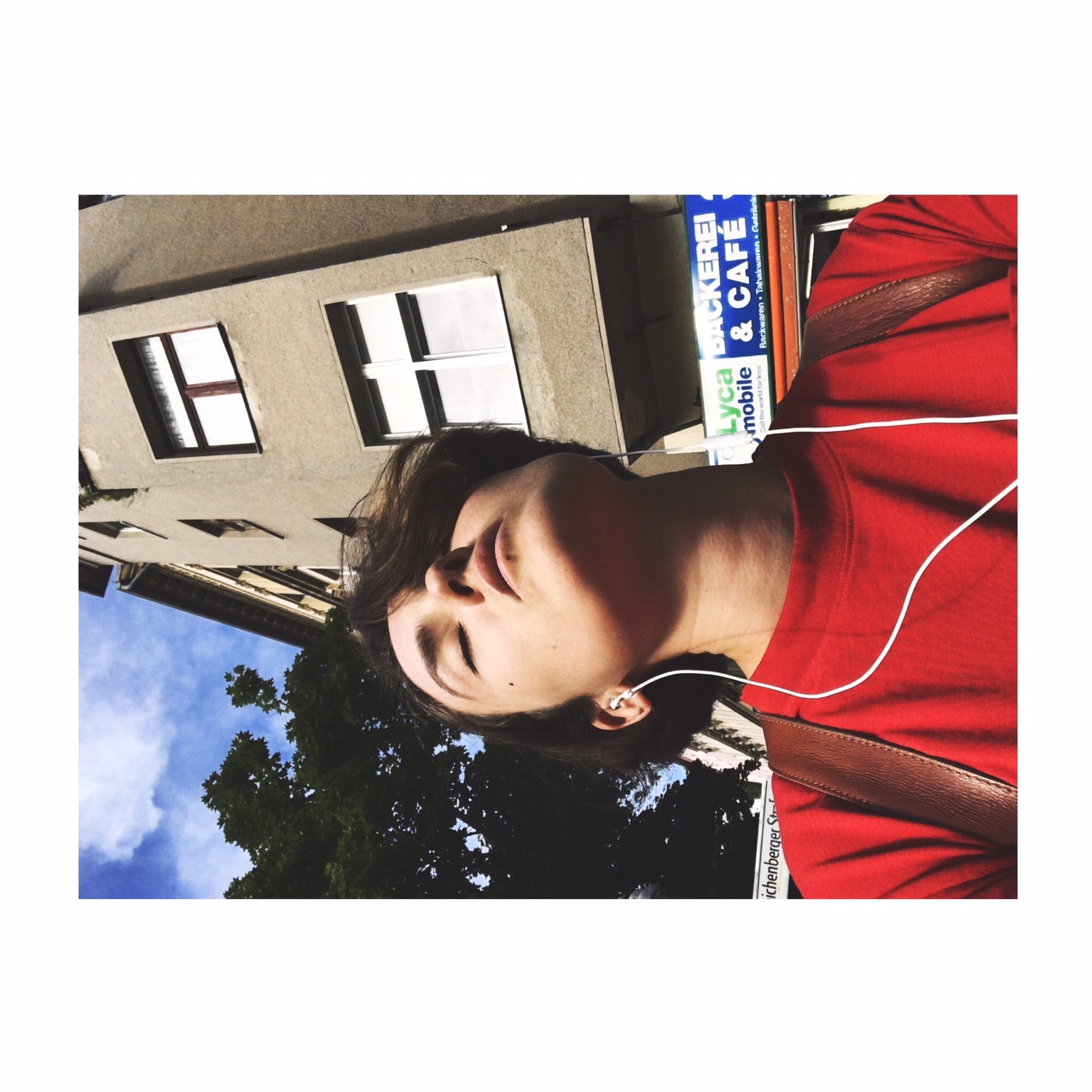
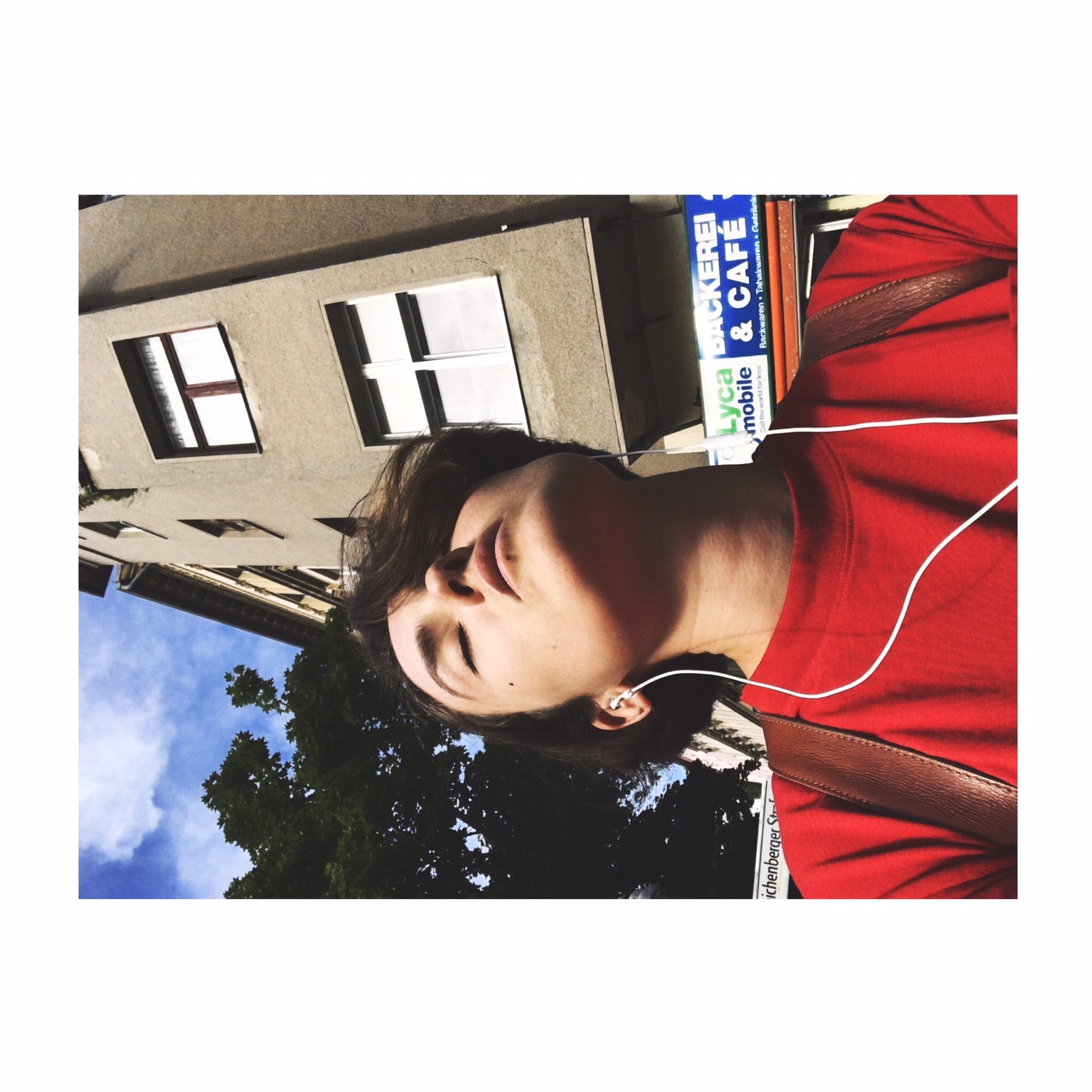
Es gibt wenig Seltsameres, als sich als Ottonormalaufsteher mit der eigenen Kreativarbeit und dem, was man so täglich in die Umlaufbahn des Internets streut in Relation zu setzen. Wir – und mit wir meine ich alle, die vom Schreiben, von der Musik, vom Dichten, Restaurieren, Malen und Kuratieren leben – haben durch unsere Passion eine Parallelwelt erschaffen, in der wir nicht nur als fokussiertes Individuum tätig sind, sondern auch einen gewissen Abstand halten, zum lebenden, sprechenden, mit Freunden auf Tanzflächen fliegenden Subjekt, das sich kurz nach Mitternacht ein Nutellabrot schmiert und ins Bett bröselt.
Noch seltsamer als die Realisation dessen ist der Moment, in dem andere Menschen das Werk rezipieren, das du ins Internet verblasen hast. Jetzt, wo ich diese Zeilen schreibe bin ich eine andere als gestern Abend in der Bar mit Vincent und eine andere, als beim Wochenendtrip nach Kopenhagen. Gerade bin ich im Flow, durch die Leiter rückwärts in meinen Kopf eingestiegen und tue das, was ich am liebsten tue: Schreiben.
Ich habe erst letztens mit meiner guten Freundin Olja über Männer gesprochen, die uns fragen, „was wir so schreiben“. Es ist der Standardsatz geworden und zu etwas verkommen, das wir beide meist bewusst ausklammern, wenn wir jemanden nicht gerade online kennenlernen – denn da ist es dank Google und Instagram unübersehbar. Wir klammern es nicht aus, weil es uns unangenehm ist. Sondern, und hier muss ich für mich sprechen, weil es etwas Intimes hat. Da kann jemand, den man mögen könnte, wie in einer öffentlichen Bibliothek Einblick in meine Gedanken nehmen, ohne mich zu erkennen.
Mich mit meiner Sprache verwechseln, sich mir auf wundersame Weise verbunden fühlen, ohne meine Basis zu kennen. Meine Vergangenheit. Diese fälschlicherweise empfundene Verbindung zu mir macht mir Angst, manchmal. Nicht nur, wenn ich liebgemeinte Leserbriefe bekomme, von Menschen, die mir ihre Geheimnisse anvertrauen und sich Rat wünschen. Es ist, als ob sie nicht mit mir kommunizieren würden, sondern mit meinem Autorinnen-Ich, dieses Ich, das ich (!) wiederum kreiere, als meine wahrnehmbare und in kleinen Stückchen im Netz konsumierbare Visitenkarte. Manchmal, ganz klar, schmeichelt es mir. Wie soll es auch anders sein? Ich investiere etliche Stunden meines Lebens in das, was ihr hier lesen könnt.
Macht das Sinn? Bin das Ich?
Ich diskutiere die Diskrepanz zwischen der Autorin und dem von ihr publizierten Text schon seit Jahren und habe immer noch keine Antwort darauf gefunden. Ja, natürlich bin Ich meine Texte (sie sind schließlich in mir entstanden) und nein, natürlich bin Ich es nicht. Jeder Text, jeder Satz ist nur ein kleiner aneinandergereihter Haufen Wörter, der meine Synapsen zu einer Zeit durchströmte, auf die mein heutiges Ich gar nicht mehr zur Gänze zurückgreifen kann.
Aber kommen wir zu etwas anderem. Welchen Einfluss hat die kreative Arbeit, die öffentlich verfügbare kreative Arbeit auf mein, auf Oljas, auf unser Liebesleben? Autorinnen scheinen gewisse Features in Männern zu triggern. Ganz so, als ob sie sich jetzt, nachdem wir in ihr Leben getreten sind endlich dazu bereit fühlen, ihr unveröffentlichtes Lebenswerk an die Frau zu bringen.
„Darf ich dir ein Gedicht schicken?“ „Nein. Es sei denn, du möchtest den Kontakt mit mir abbrechen.“
Es gibt durchaus Männer, die uns via DM, PN oder E-Mail ungefragt auf ihr im stillen Kämmerlein fabriziertes Meisterstück aufmerksam machen wollen. In letzter Zeit häufen sich die Zwischenfälle. Manche glauben auch, dass ich ihnen kostenlos als Coach zur Verfügung stehe, und ihr Material redigiere. „Ich klicke aus Prinzip nicht auf YouTube-Links“ hatte Olja einmal auf ihrem Datingprofil stehen. Als ich nachfrage, warum, erzählt sie mir, dass ihr Ego nicht davon abhängt, ob jemand weiß, dass sie Autorin ist oder ohne diese Info irgendwann als abgelegter Kontakt im Smartphone stirbt. Gesund, eigentlich.
Bei manchen Männern scheint das irgendwie anders zu sein. Sie schicken uns niemals veröffentlichte Theatertexte, zeigen uns ihre postpubertären Musikrezensionen über Nischenmusik aus dem Jahre 2011, schicken Screenshots von Podcasts und Links zur streng geheimen ersten EP. Fast so, als ob ihre virtuell übermittelte Künstlerexistenz alleine reichen müsste, uns um den Finger zu wickeln. Uns zu zeigen, dass sie es wert sind, oder dass wir es vielleicht wert sind, sie in ihrem Schaffen zu unterstützen und zu würdigen. Aber, schon mal daran gedacht, vielleicht ist das gar nicht die Art, auf die wir euch näher kommen wollen.
Unerwünschte Links zu eigenen Artikeln, Portfolios oder Soundcloud-Profilen sind die Dickpics der kreativen Zunft. Neben Dickpics.
— Caren (@carens_tweets) 8. August 2017
Die Frage bleibt: Wieso ist es manchen Menschen ein Anliegen, ihre künstlerische Präsenz in den Fokus einer ersten Interaktion zu stellen, während es andere sogar ablehnen? Das ganze Frau-Mann-Allesdazwischen-Ding mal außen vorgelassen. Haben wir vergessen, wer wir sind, sobald wir die Gitarre wieder ins hinterste Eck der WG gestellt haben?
Ich finde es spannend, was jemand tut – keine Missverständnisse an dieser Stelle bitte und wer noch nie unaufgefordert über seine Arbeit gesprochen hat, werfe das erste Mikrophon. Aber wenn kein Unterschied mehr zwischen der öffentlichen und der privaten Person zu finden ist, wird es gruselig. Wenn man das Gefühl hat, der oder diejenige lebt nur für die Bestätigung. Die ständig hinterherhechelnde Meute, das Publikum. Wann kann Ambition, wann kann Passion zu weit gehen und den Kern einer Persönlichkeit ersetzen? Wo bleibt die Balance, das gesunde Mittelmaß?
Vielleicht liegt es an der Angst, nicht mehr gemocht zu werden – ohne dem, was uns scheinbar ausmacht. Von dem wir uns lange genug eingeredet haben, dass es uns ausmacht. Was uns zumindest beruflich geholfen hat, jemand zu werden – ob man das jetzt im klassischen Sinne verstehen möchte oder nicht. Vielleicht ist genau das der Grund, warum sich Kreativschaffende nicht ständig mit dem Werk des potenziellen „Love Objects“ beschäftigen sollten. Weil es den Blick verstellt und keinen Platz lässt, für die Erforschung der Person dahinter.
If you love someone, don’t subject them to:
1) your poor decisions
2) apologies they don’t wanna hear
3) any kind of fuckshit you create
— SUI GENERIS CUNT (@YeoshinLourdes) 17. Juni 2017
Für die Person, die nicht sofort sichtbar ist. Eigenheiten und Aspekte, die nicht unmittelbar geteilt werden. Die, die nur in bestimmtem Licht zu anderen Tageszeiten zum Vorschein kommen. Dann und nur dann, wenn man auch weiß, welche Knöpfe man drücken muss. Es ist keiner auf dem Smartphone, das verspreche ich euch.
By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
