Yellowface – Über weibliche Grausamkeit in der Publishing Industry
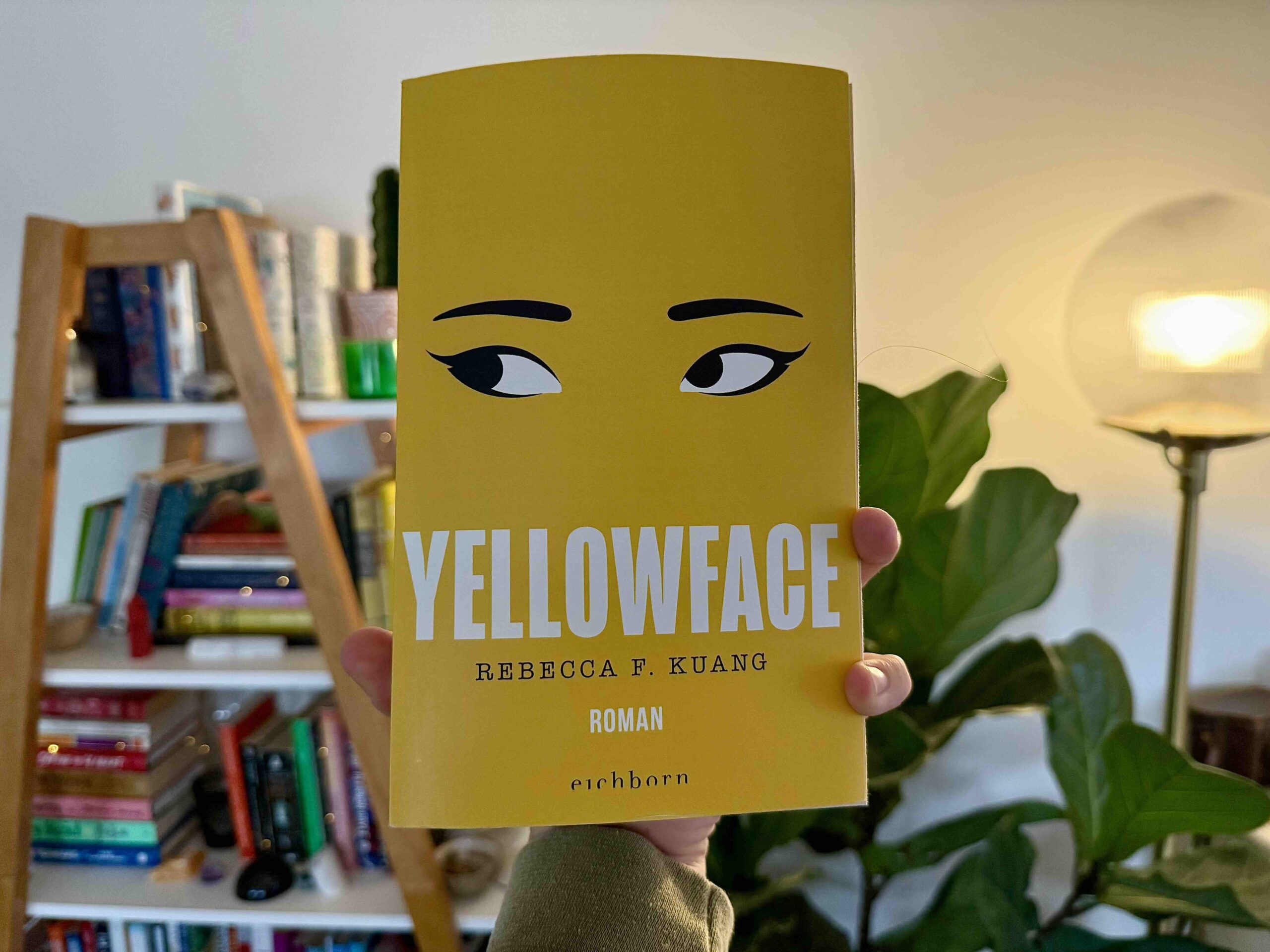
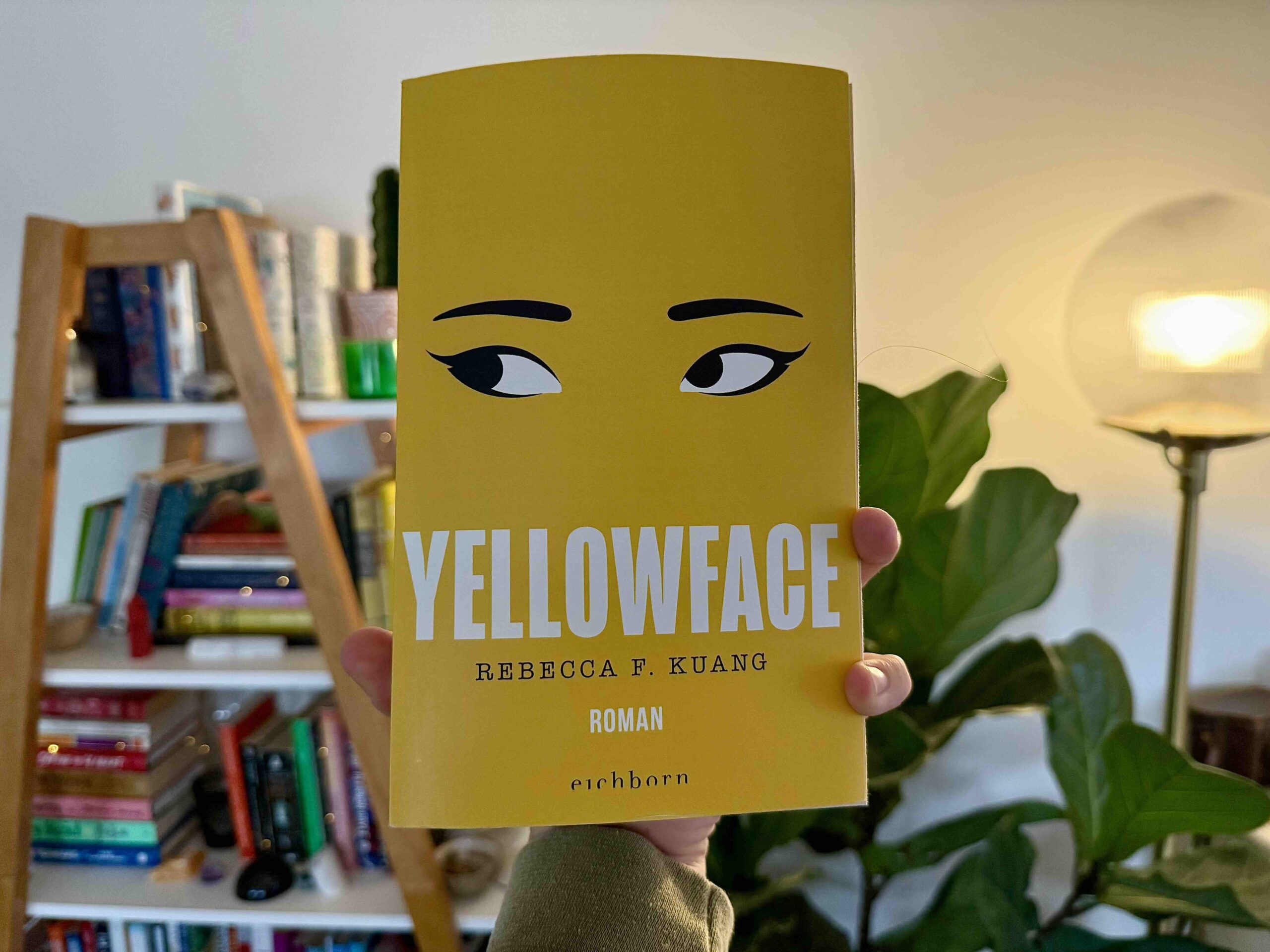
Tut mir leid mir ist kein besserer Titel eingefallen, denn von was sonst handelt bitte dieser unfassbar packende Roman von Rebecca F. Kuang, den ich viel zu spät und dann in einer Tour im Flugzeug durchgelesen habe?
Der Plot dürfte mittlerweile bekannt sein. Die allseits beliebte und von der Presse hochgelobte Bestsellerautorin Athena Liu stirbt bei einem Pancakes-Wettessen mit ihrer Autorinnen-„Freundin“ June Hayward, die daraufhin Athenas maschinell getipptes Manuskript aus dem Nebenzimmer klaut, editiert und als ihr eigenes ausgibt.
Das Problem dabei: Die Geschichte handelt von der chinesischen Arbeitsfront im 1. Weltkrieg – ein Thema, mit dem sich die weiße June nicht auskennt, das sie sich allerdings im Laufe der nächsten Monate bei der Überarbeitung aneignet wie ihr eigenes. Schließlich veröffentlicht es ein Verlag unter dem Pen-Name Juniper Song (Erster + zweiter bürgerlicher Vorname der Autorin), um den Eindruck zu erwecken, Juniper sei selbst asiatisch-amerikanisch. Ok wow! Das crazy. Und: kein besonders schlauer Move.
Rebecca, wie kann man so eine geniale Idee haben? Yellowface ist eine unterhaltsame und akkurate Parodie auf die knallharte Buchbranche, die für Neo-Autorinnen erfahrungsgemäß eher undurchsichtig wirkt.
Antworten, die sich einem erst nach Jahren im Betrieb so langsam offenbaren, werden den Leserinnen von R.F. Kuang schonungslos um die Ohren gehauen.
Das liegt natürlich auch daran, dass Kuang mit dem Thema „Repräsentation“ als asiatisch-amerikanische Autorin selbst genug Erfahrung hat. Auch „witzig“ (und absolut typisch für die Publishing-Industrie): Nachdem Kuangs Literaturagent Teile des ersten Entwurfs gelesen hatte, zögerte er zuerst, das Projekt weiterzuverfolgen, und versuchte, Kuang davon abzubringen, da er den Inhalt als Angriff auf die Verlagsbranche empfand (lol). Auf Kuangs Drängen hin wurde das Projekt jedoch fortgesetzt und schließlich von HarperCollins veröffentlicht. Na Gott sei Dank!
Was mich beim Lesen am meisten umtrieb? Wieso hassen und beneiden sich Frauen in der Autorinnen-Bubble so sehr? Rebecca Kuang hat darauf ein paar Antworten aus der Sicht der erfolglosen, weißen Juniper geliefert. Juniper hasst Athena, weil sie trotz, oder gerade wegen ihres Backgrounds besser vermarktbar ist, als sie selbst. Aber nicht nur. Sie hasst Athena auch, weil sie sich die Gefühle anderer Menschen zu Recherchezwecken anhört, umschreibt und schließlich ihren Charakteren in den Mund legt.
Und sie hasst Athena, weil die beiden – eigentlich – dieselbe Ausgangslage hatten, an derselben Uni in Yale studierten und dann ein paar Jahre später trotzdem an völlig unterschiedlichen Punkten in der Karriere stehen. Während Junipers erster Roman floppte, woraufhin sie von ihrem Lektor als Autorin zweiter Klasse degradiert wurde, scheint es Athena mühelos zu gelingen, einen Hit nach dem anderen zu landen und dabei auch noch sexy in die Kamera zu lächeln.
Wenn Juniper mit Athena unterwegs ist, wird sie ganz klein. Eigentlich möchte sie die Treffen lieber absagen, als sich wieder ihre Angeberei anzuhören – aber dann sagt sie doch immer wieder zu, aus Mangel an Alternativen und auch ein bisschen aus Informations-Gier.
Oder ist es vielleicht doch möglich, dass zwei Autorinnen unterschiedlicher „Kaliber“ miteinander befreundet sind, ganz ohne Neid oder der heimlichen Hoffnung, dass die andere mit dem nächsten, schlechterlaufenden Buch auf dem Abstellgleis – oder zumindest wieder neben einem, auf dem Boden – landet?
In einer Branche, die Gelder so knapp kalkuliert und in der nur wenige an der Spitze stehen können; wundert es nicht, wenn der Herkunfts- und Gender-Konkurrenzdruck zwischen zwei Autorinnen steht.
Dass sich die eine von der anderen getriggert fühlt, wenn diese mehr Anfragen, mehr Interviews und in letzter Folge auch: mehr Gelder bekommt. Wir leben schließlich immer noch im Kapitalismus, und eine Autorin muss auch essen.
Zeig mir eine Autorin, die noch nie die aktuellsten Programm-Verlagsvorschauen nach den Titeln ihrer Konkurrentinnen abgesucht hat. Funfact: Jede weiß genau, wer ihre Konkurrentinnen sind. Wir wissen, mit wem wir intern verglichen werden – und mit wem wir uns später um die wenigen Plätze auf prestigeträchtigen Lesebühnen „streiten“.
Es kann nur „so und so viele“ feministische oder asiatische oder postost oder muslimische Autorinnen auf einem Markt geben, bevor dieser – angeblich – von diesen „marginalisierten“ Perspektiven übersättigt ist.
Da hat Rebecca Kuang meiner Meinung nach tatsächlich etwas sehr Wahres auf den Punkt gebracht. Es herrscht eine künstliche Verknappung der möglichen Startpositionen, und sind sie erstmal besetzt, sind die Gelder erstmal auf das „richtige Pferd“ gesetzt, hat es besser zu spuren.
R.F. Kuang kennt das Game, sie kennt die obsessiven Gedanken jeder Autorin in- und auswendig, vermutlich, weil sie diese am eigenen Leib durchlebt hat. Auch die problematischen Aussagen der weißen Juniper über chinesisches Essen („viel zu fettig“) und ihr latenter Rassismus gegenüber nicht-weißen Frauen werden hervorragend gezeichnet. So hervorragend, dass mir beim Lesen manchmal fast schlecht wurde, wenn es nicht so wahr, und so lustig gewesen wäre.
Sind weiße Frauen in der Literaturbranche am Ende die neuen „alten, weißen Männer“? Die, die POCs am liebsten kündigen lassen würden, weil sie auf Sensitivity Readings bestehen? Brauchen sie unser Mitleid, wenn ihre generischen Titel mit 08/15-Lebensweisheiten floppen?
Es ist absolut großartig, wie Rebecca F. Kuang dieser ach-so-liberalen und weltoffenen Branche den Spiegel vorhält; wie sie die fehlende politische Awareness einer ranghöheren, weißen Lektorin aufzeigt; wie sie die Shit-Storms unserer Zeit nachahmt und uns in ihre Gewalt mithineinzieht.
Es ist alles leider ein bisschen zu wahr, um nach Yellowface nur mit einem guten Gefühl rauszugehen. Dafür macht sich nach dem Lesen hoffentlich keiner mehr Illusionen, sich mit dem Schreiben als Frau im Patriarchat unbedingt viele echte Freundinnen zu machen.
By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
