„She Works Hard For No Money“ in der Review
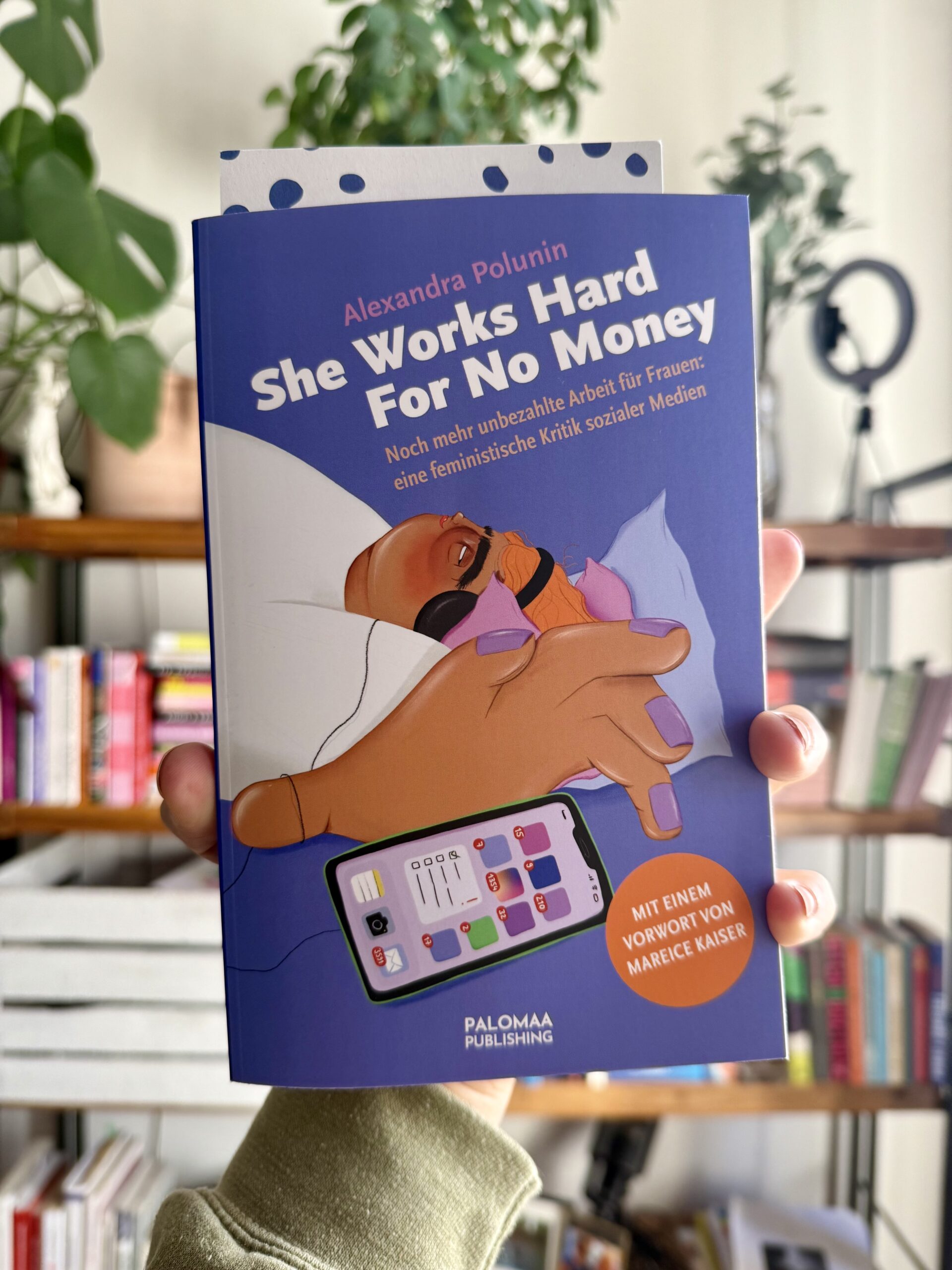
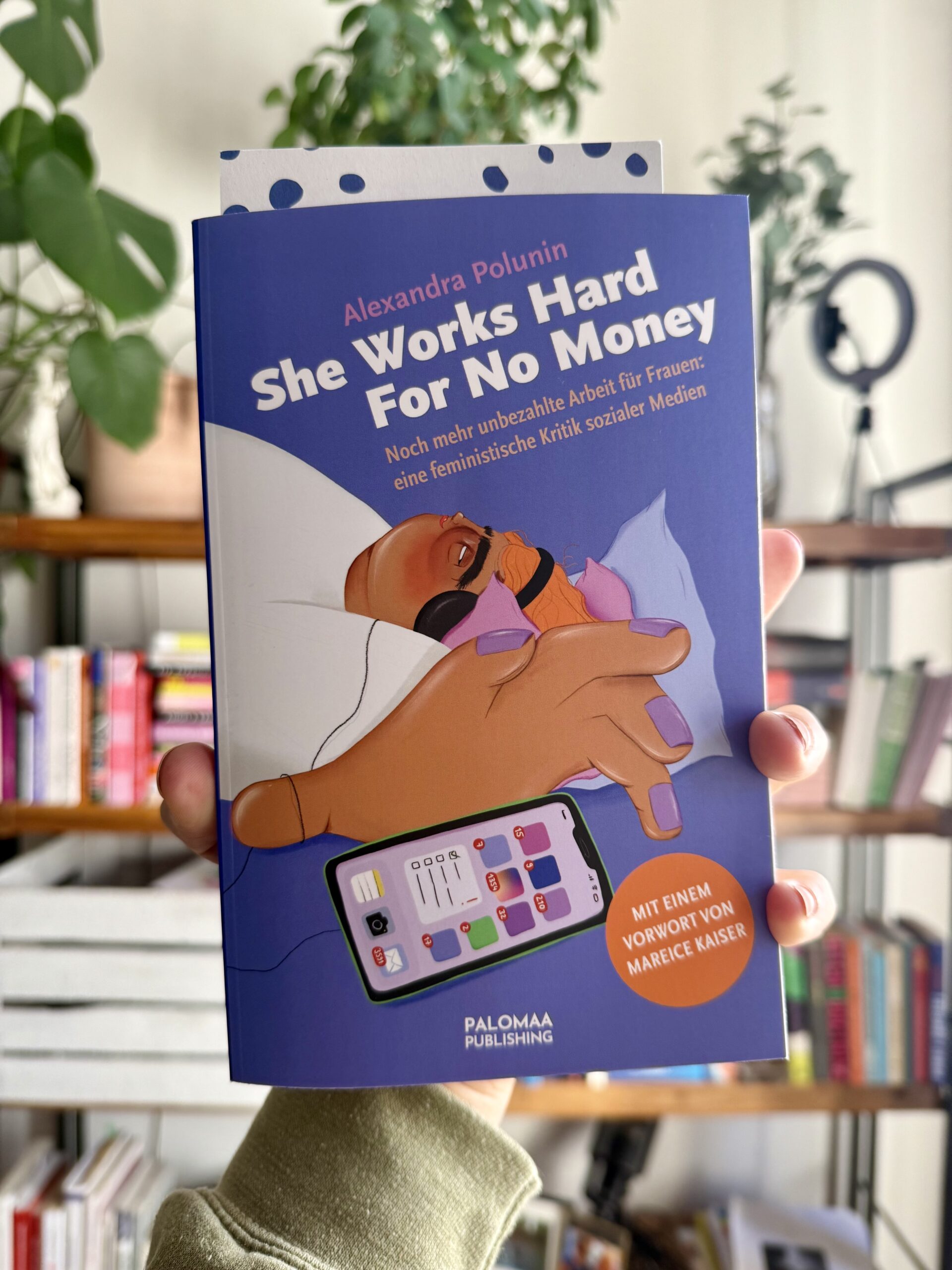
„Noch mehr unbezahlte Arbeit für Frauen“ – der Untertitel des neuen Buchs von Alexandra Polunin hat mich sofort gecatcht. Natürlich, schließlich kritisiere ich genau das selbst seit Jahren. Nach unzähligen, gescheiterten Instagram-Exits (yo, ich bin immer noch drauf) war ich gespannt, ob mir jemand eine Lösung präsentiert, die ich nicht schon kenne.
Die Antwort darauf? Naja. Fangen wir erstmal von vorne an.
So wie feministische Bewegungen einst darauf bestanden, Fürsorge, Haushalt und emotionale Arbeit überhaupt erst als Arbeit anzuerkennen – also als etwas mit Wert, Aufwand und gesellschaftlicher Relevanz –, fordert Polunin dasselbe nun für Social Media. Auch hier wird tagtäglich enorm viel Zeit, Energie und Kreativität investiert, ohne dass diese Tätigkeiten als „richtige Arbeit“ gelten oder entlohnt werden.
Während Care-Arbeit lange als selbstverständlich, privat und „aus Liebe“ geleistet galt, funktioniert Social Media nach einem ähnlichen Muster: Userinnen füttern Plattformen mit Content, Aufmerksamkeit und Interaktion – unbezahlt, aber essenziell für deren Bestehen. Polunin argumentiert, dass erst durch eine Erweiterung des Arbeitsbegriffs sichtbar wird, wie viel unbezahlte, aber systemerhaltende Arbeit hier stattfindet. So wie Care-Arbeit das Fundament der Gesellschaft bildet, hält die unsichtbare, unbezahlte Social-Media-Arbeit das digitale Ökosystem am Laufen – und bleibt dabei ebenso wenig anerkannt wie einst die Fürsorgearbeit zu Hause.
Diese unsichtbare, aber systemerhaltende Arbeit auf Social Media unterteilt Polunin anschließend in verschiedene Formen – eine Art Care-Arbeitsverzeichnis für die digitale Sphäre. Sie unterscheidet fünf Kategorien, die alle zeigen, wie umfassend Social-Media-Arbeit tatsächlich ist:
Besonders deutlich wird Polunins Argument, als sie beginnt, nachzurechnen, was all diese unbezahlte Social-Media-Arbeit eigentlich wert wäre. Wenn man – wie sie – von einem vergleichsweise niedrigen Stundensatz von 50 Euro ausgeht und ansetzt, dass viele Frauen täglich etwa zwei Stunden mit Contentarbeit verbringen, landet man bei rund 36.500 Euro pro Jahr. Geld, das niemals ankommt – weil „uns eingeredet wird, dass wir das alles nur zu unserem Vergnügen machen.“
„Statt unbezahlte Contentarbeit zu problematisieren und zu kritisieren, bestimmen Plattformbetreiber und Social-Media-Coaches den Diskurs“, so Polunin. „Sie reden uns ein, dass es absolut fein sei, unbezahlt Content für sie zu erstellen. Dass es total normal sei, alles, was einem durch den Kopf geht, für alle sichtbar ins Netz abzuladen und das auch an unseren Feierabenden, am Wochenende und im Urlaub zu tun. (…) Dass unsere Gedanken, Erlebnisse und unser Wissen der Welt nun mal zustünden, weil es immer jemanden gibt, der von dem, was wir posten, profitiert. Wir haben diese Annahmen nach nur zwanzig Jahren Social Media so weit verinnerlicht, dass es unmöglich, ja sogar undenkbar erscheint, diese unbezahlte Arbeit einfach nicht zu leisten.“
Es gibt längst unzählige Bücher zu genau diesem Thema – angefangen bei Jenny Odells Bestseller How to Do Nothing – Resisting the Attention Economy (Melville) bis hin zu Influencer – Ideologie der Werbekörper (Suhrkamp) von Ole Nymoen.
Auch glaube ich nicht, dass es irgendwem in den letzten fünf Jahren entgangen ist, wie viel mentale Kapazität in Social Media fließt, wie sehr Social-Media-Konsum unsere Psyche belastet oder dass unbezahlte Arbeit auf diesen Plattformen ein strukturelles Problem darstellt.
Ehrlich gesagt: Das ganze Internet ist voll von dieser Kritik. Fast alle meine Lieblings-YouTuber*innen haben schon ein Video über Burnout gedreht, und es vergeht kaum eine Woche, in der nicht wieder jemand ankündigt, eine Pause zu machen – aus genau diesen Gründen. Social-Media-Kritik ist – zumindest in meinem Umfeld – absolut Mainstream.
Sie ersetzt den schwammigen Begriff Burnout durch eine klarere Kategorisierung: Contentarbeit, Ästhetische Arbeit, Emotionsarbeit, Selbstoptimierung, Mental Load. Aus medienwissenschaftlicher Sicht ist das durchaus relevant, weil es dem Diskurs Struktur und neue Begriffe verleiht.
Inhaltlich neu waren ihre Thesen für mich trotzdem nicht. Viele Passagen – etwa zu Toxic Positivity, Rage Bait oder Clean-Girl-Diskursen – habe ich schlicht überblättert, weil ich das alles schon zu oft gelesen habe.
Der Teil mit den Lösungsvorschlägen kommt erst auf Seite 257 von 285 – und liefert im Grunde dieselben Ideen, die Jenny Odell schon 2019 formulierte: Weg von den großen Plattformen, hin zu unabhängigen Räumen. Zurück zu Blogs, Newslettern und Messengern statt endlosem Scrollen. Alles richtig – aber das Schreiben von Blogposts wie diesem hier bringt in der Regel eben auch kaum Geld ein. (Übrigens: hier kannst du meine unbezahlte Content-Arbeit mit einem Abo auf Steady unterstützen.)
Wenn Polunin also konsequent wäre in ihrer Kritik an unbezahlter Arbeit, müsste sie eigentlich auch die Buchbranche in ihre Analyse einbeziehen. Denn viele Autorinnen erhalten gar keinen Vorschuss, obwohl sie Jahre an einem Manuskript arbeiten. Vielleicht ist Buchschreiben keine klassische „Contentarbeit“ und ja, auch die Emotionsarbeit ist im Vorfeld meist niedriger, aber schlecht bezahlt ist es allemal. Und in diesem Fall ist nicht Social Media das Problem, sondern ein strukturelles Missverhältnis in der gesamten Kultur- und Kreativwirtschaft.
Die Debatte müsste also breiter geführt werden. Nicht nur: „Social-Media-Arbeit ist schlecht bezahlte Arbeit“, sondern vielmehr: „Kulturarbeit, Contentarbeit und Care-Arbeit im gesamten linken Kunst- und Mediensektor sind chronisch unterbezahlt.“ Das wäre die eigentlich radikale Erweiterung ihres Arguments.
Das heißt aber nicht, dass Polunin falschliegt. Im Gegenteil: Ich mochte ihren Stil, ihren Humor und die vielen Anekdoten, die mich immer wieder zum Schmunzeln gebracht haben. Nur gelernt habe ich – als Autorin und Medienwissenschaftlerin, die seit über zehn Jahren von Mitgliedschaftsmodellen, Sponsorings und Honoraren lebt – ehrlich gesagt nichts Neues. Alle Strategien, die Polunin vorschlägt, habe ich längst ausprobiert – mit sehr unterschiedlichem Erfolg.
Was sie zudem kaum erwähnt: Wie ungleich die Voraussetzungen sind. Von jetzt auf gleich einen erfolgreichen, also bezahlten Newsletter oder unabhängigen Blog als „Alternative“ zu starten, funktioniert natürlich leichter, wenn man bereits 100 000 Follower*innen auf Instagram hat.
So oder so: Relevanz und Prominenz kommen nicht von irgendwoher. Ich bin die Letzte, die sagt: „Bitte, beute dich bis zum Burnout im Internet aus.“ Aber ganz ohne Selbstdarstellung wird es wohl auch in Zukunft nicht klappen. Weder mit der Karriere als Influencerin, noch der als Buchautorin.
Trotzdem finde ich: She Works Hard for No Money (Palomaa Publishing) sollte Pflichtlektüre an Schulen sein. Nicht, weil es bahnbrechend Neues erzählt, sondern weil es dem Beruf „Influencer“ seinen Glanz nimmt – und jungen Menschen zeigt, was tatsächlich hinter einer Karriere in der Medienbranche steckt.
By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
